Sie möchten über neue Blogeinträge benachrichtigt werden? Dann bitte gern per Mail an kopatz@oekoroutine.de anfordern.

Moralisch korrekt!?
In dieser Woche sprach ich mit einem Freund aus Marburg über Ethik und Moral in der Klimaschutzdebatte. Es sei richtig, über das »richtige« Verhalten nachzudenken, es zu reflektieren. Aber es einzufordern, also zu moralisieren, sei falsch.
Auslöser war meine Anmerkung, dass eine Freundin zwei Untermieter in ihrem Einfamilienhaus hat, weil sie der Meinung war, so viel Platz für eine Person, sei unangemessen. Dafür muss sie viele
Kompromisse eingehen, insbesondere ihre Küche teilen. Und sie stellt den Mitbewohnern auch das Wohnzimmer für die gemeinsamen Nutzung zur Verfügung.
Keine Frage, das ist eine Superstrategie gegen Einsamkeit und verbessert ihre finanzielle Situation. Aber es ist auch eine Einschränkung. Sie kann nicht mehr so schalten und walten, wie es wäre, wenn sie alleine in dem Haus wohnen würde, welches übrigens für heutige Maßstäbe mit 120 m² gar nicht so groß ist.
Jedenfalls habe ich dem Freund gesagt, dass ich das vorbildlich finde. Denn es ist ja nun mal ein Problem, das in unserer Gesellschaft der persönliche Anspruch bei der Wohnungsgröße extrem
zugenommen hat. Der Mensch ist maßlos, jedenfalls die große Mehrheit von uns. Ich kann mir eigentlich keinen Luxus vorstellen, der nicht zum Standard werden würde, sobald es auch für Menschen mit
normalem Einkommen bezahlbar ist.
Die Größe einer Wohnung bemisst sich in den meisten Fällen nicht am Bedarf, sondern am Gehalt. Und so ist es heutzutage ganz normal, dass ein kinderloses Paar eine Wohnung mit 95 m² bezieht –
wenn das Gehalt es erlaubt. Oder auch gerne mal an ein Einfamilienhaus, dazu mehr in der nächsten Kolumne.
Um auf das Gespräch mit meinem Freund zurückzukommen. Der hat sich richtig darüber aufgeregt, dass ich das Verhalten meiner Freundin als vorbildlich bezeichnet habe. Er zeigte sich super genervt
von dieser Moralisierung. Also, dass man die Leute anklagt, wegen ihres nicht klimaschutzkonformen Verhaltens. Das würde überhaupt zu nichts Positivem führen, eher ganz im Gegenteil, würde das
die Aggression gegen Grüne Politik noch verstärken.
Ich war natürlich sehr empfänglich für diese Botschaft. Schließlich habe ich ein Buch mit dem Titel »Schluss mit der Ökomoral« veröffentlicht – welches übrigens kostenlos via Open Access
verfügbar ist.
Ich gab ihm also recht, habe aber zugleich klargestellt, aus meiner Sicht sei es besonders bei Menschen, die sich für den Klimaschutz engagieren, nicht unwichtig, ob sie mit gutem Beispiel
vorangehen. Gewiss, letztlich geht es um die strukturellen Veränderungen. Die Energiewende kam nicht ins Laufen, weil sich die Menschen in den achtziger Jahren moralisch korrekt verhalten haben,
sondern weil Gesetze dazu geführt haben, dass es sich gelohnt hat, zu investieren.
Und auch das Elektroauto wird nicht automatisch zum Massenverkehrsmittel, sondern nur, weil die Europäische Union die Industrie durch die Vorgabe von Standards in diese Richtung drängt. Und eines
Tages wird es nur noch Elektroautos beim Händler geben. Und die Menschen tun das richtige, ohne moralische Appelle.
Aber dennoch ist es nicht egal, ob jemand, der sich öffentlich wahrnehmbar für die Verkehrswende engagiert und in seinen Botschaften verbreitet, dass die Zahl der Autos in den Städten abnehmen
sollte, weil die Menschen in urbanen Regionen darunter leiden, ob diese Person ein Auto besitzt oder gar einen 2,5 Tonnen schweren SUV.
Darüber machen die Leute sich dann lustig und nehmen diese Person nicht ernst. Werner meinte dazu, es wäre geradezu am besten, wenn ich mit einem fetten Porsche zum Vortrag fahre und dort
zugleich dafür werbe, dass politische Rahmenbedingungen es quasi unmöglich machen, ein solches Fahrzeug zu betreiben. So könne man am besten den Eindruck einer moralischen Anklage vermeiden. Das
würde mich geradezu am glaubwürdigsten machen.
Damit hat er vielleicht sogar recht, wenn man beispielsweise vor sogenannten Geschäftsleuten spricht. Da lautet die Botschaft quasi: „Ich bin einer von euch, hänge auch an meinem dicken Auto.
Daher brauche ich politische Vorgaben, um von dieser Sucht loszukommen.“
Also, ich bin da hin und hergerissen. Meine Erfahrung ist, dass ich fast bei jedem Vortrag gefragt wurde, mit welchem Verkehrsmitteln ich denn gekommen sei, ob ich ein Auto besitze und so weiter.
Exemplarisch, mit einer gewissen Empörung in der Stimme: „Ich habe gehört, dass Sie mit einem Wohnmobil im Urlaub waren. Stimmt das?“
In meinem Vortrag habe ich 30 Minuten darüber gesprochen habe, es käme nicht darauf an, dass sich die Leute persönlich ethisch korrekt verhalten. Viel wichtiger sei, sich für die Veränderung der
politischen Rahmenbedingungen zu engagieren. Aber diese Botschaft verfängt nur schwer. Quasi intuitiv betrachten die Leute das persönliche Verhalten.
Zurück zu Anfang. Was ist der Unterschied zwischen Ethik und Moral?
Moral beschreibt die konkreten Regeln und Werte, die eine Gesellschaft oder eine Person für richtig und gut hält. Ethik hingegen ist die wissenschaftliche Reflexion über diese Moral, die sich mit
den Grundlagen und Rechtfertigungen moralischer Prinzipien befasst.
Was heißt das nun für mich? Ich weiß nicht genau. Ich kann zumindest für mich feststellen, dass ich die Anklage vom Fehlverhalten für falsch halte. Das macht aus meiner Erfahrung nur schlechte
Stimmung und verändert eigentlich nichts.
Zugleich versuche ich, mit gutem Beispiel voranzugehen. Das macht mich in den Augen von bestimmten Milieus zu jemanden, der als radikal wahrgenommen wird. Hingegen machte es mich bei anderen
Gruppen, besonders solchen, die sich intensiv für Klimaschutz engagieren, zu einer glaubwürdigen Person.
Von überflüssigen Parkplätzen und wie man das verhindern kann
Verkehrswende und Parkplatzwachstum, das passt nicht zusammen. Was hier gepflastert ist, war einmal Garten. Man sehr gut erkennen, was die Satzung für Grünflächen bedeutet
StVO-Novelle fördert Verkehrswende
Das große Ziel der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ wurde nicht erreicht. Rund 1130 Kommunen - in denen die Hälfte der deutschen Bevölkerung lebt - haben sich dafür eingesetzt, dass sie selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden – zielgerichtet, flexibel und ortsbezogen - genau so, wie es die Menschen vor Ort brauchen und wollen!
Diesen Schritt verwehrten CDU/CSU und FDP, in der Regel gilt auf Hauptstraßen weiterhin Tempo 50.
Warum sind manche Parteien so mutlos? Weil die Tempo 30 Gegner so radikal sind. Ein Beispiel: Die Gemeinde Antfeld im Sauerland, keine 1000 Einwohner, hat für die Bundesstraße Tempo 30
angeordnet. Die Lärmbelastung durch täglich 10 000 Pkw und Lkw war einfach zu extrem. Das Limit vermindert den empfundenen Lärm um fast die Hälfte. Was für eine Wohltat für die Anwohnenden!
Einige Auto- und Lastfahrer macht das Limit wütend. Wie die Presse berichtet, haben sie Schilder bemalt und aus 30 eine 80 gemacht. Manche fahren hupend durch den Ort, bisweilen frühmorgens.
Andere schießen mit Böllern oder lassen aus Protest gegen das Tempolimit den Motor aufheulen.
Es sind wenige Menschen, die so reagieren. Das bürgerliche Lager im Bundestag und Bundesrat schlägt sich also auf die Seite einer Minderheit. Erklären kann ich es mir nicht. Aber immerhin haben
die Bremser nicht alles blockiert und einige sehr grundsätzliche Veränderungen der Verkehrsordnung auf dem Weg gebracht.
Zukünftig können Kommunen auf der Straße einfacher Platz für Busse, Fahrrad- und Fußverkehr schaffen. Denn durch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) im letzten Sommer können die
Städte im Straßenverkehr endlich den Klima- und Umweltschutz, die Gesundheit und die städtebauliche Entwicklung berücksichtigen. Auch die Einführung von Tempo 30 und Parkraumbewirtschaftung wird
einfacher.
„In kurzer Zeit werden wir eine große Welle an Maßnahmen auf den Straßen sehen – einen Boost für die Sicherheit und die Lebensqualität vor Ort“, sagt Swantje Michaelsen, Bundestagsabgeordnete und
Verkehrspolitikerin der Grünen, voraus.
Es ist ein Segen, dass Grüne und SPD die vorliegende Reform der StVO herausgehandelt haben. Drei Jahre haben sich die Verantwortlichen dafür beharrlich eingesetzt.
Danke, danke, danke!
Gerade hat der Bundesrat eine letzte Verwaltungsvorschrift verabschiedet, jetzt kann es losgehen.
Liebe Tante Emma!
Ich erinnere mich noch gut an einen Urlaub in Frankreich. So viele schöne Dörfer mit Ortskern und nicht wie in Deutschland häufig anzutreffen, Straßendörfer ohne Mitte. Was mich in Frankreich sehr verwundert hat, dass selbst die kleinsten Dörfer noch einen Schlachter hatten, einen Bäcker und einen kleinen Supermarkt. Warum ist das so? Ganz einfach: Die Menschen in Dörfern kaufen offenbar in diesen Läden ein.
In einem Bistro habe ich es selbst erlebt. Neben uns saßen drei ältere Herren am Tisch, den Wein aus dem Laden um die Ecke, das Baguette aus der Bäckerei und die Pastete vom Schlachter daneben.
Und das Dorf hatte nur 700 Einwohner!
Diese Form von Lokalpatriotismus scheint den deutschen Schnäppchenjägern wohl abzugehen. Hierzulande haben die kleinen Läden nicht nur in den Dörfern geschlossen, sondern auch in vielen Teilen
der Großstädte.
Der kleine Laden um die Ecke, war zu meiner Kindheit eine Selbstverständlichkeit. Der eine war 200 Meter von der Wohnung entfernt, der nächste – bekannt für seine Schlachterei – 600 Meter. Zur
gleichen Zeit gab es auch schon große Supermärkte. Marktkauf, das war so einer. Da fuhr man mit dem Auto hin und machte den Großeinkauf. Nach und nach haben die kleinen Läden aufgegeben.
Ältere Menschen, die selbst gar nicht mehr mit dem Auto zu den großen Märkten fahren konnten, haben ihre Kinder oder Enkel mit den Einkäufen beauftragt. Und somit das Problem verschärft. Am Ende
müssen jetzt alle junge , wie alte Menschen, ob mit oder ohne Auto, ziemlich lange Wege in Kauf nehmen, um selbst nur ein Pfund Butter zu kaufen. Die Kleinigkeiten, die man beim Großeinkauf
vergessen hat, dafür muss man heutzutage im ländlichen Raum ins Auto steigen.
Umso mehr freue ich mich über den kleinen Laden bei mir in Marburg um die Ecke. Mit seinem Format würde er bestimmt 6x in einen Discounter heutigen Größe passen.
Und damit der kleine Laden dort auch bleibt, habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, dort regelmäßig so viel wie möglich einzukaufen. Obst, Sekt, Kekse, was sich gerade ergibt. Ich bin auch
dankbar, dass nicht zuletzt REWE und Edeka mit ihren genossenschaftlichen Betriebsstrukturen, diese Form der Nahversorgung überhaupt möglich machen.
Im kleinen Laden muss ich nicht lange suchen. Man kennt das Personal, und es herrscht eine familiäre Atmosphäre. Mir ist bewusst, dass die keine großen Gewinne machen, umso mehr freue ich mich
darüber.
Und das habe ich den Betreibern neulich auch gesagt: Ich liebe diesen Laden. Toll, dass es euch gibt, vielen Dank!
Ich finde diese Form der Nahversorgung extrem wichtig. Es sind zugleich Orte, der Begegnung. Sie stehen für Gemeinschaft statt Gegeneinander.
Und daher mein Appell: Kauft in den kleinen Supermärkten ein solange es sie noch gibt.
Wie die AfD Migration fördert
Das klimapolitische Himmelfahrtskommando der AfD verschlimmert den Migrationsdruck in kühle Regionen wie Deutschland
FairParken

Die Gaslüge

Nach Flugtaxi-Pleite: Warum es besser ist, wenn das Auto nie fliegen lernt

Die Zukunft der Innenstadt

Mitgefühl
Wer meint, ich habe etwas gegen Autos, liegt falsch. Ich habe Mitgefühl. Mit den Menschen, an lauten Straßen, mit den Eltern, deren Kinder auf der Straße einen schweren Unfall hatten und besonders mit den Eltern, deren Kind im Straßenverkehr gestorben ist, die zuversichtlich ihren Kindern das Fahrradfahren beigebracht haben. Und ihr Kind im Alter von zwölf Jahren verloren haben. Ich habe bei meinen Freunden mitbekommen, was das bedeutet. Vor Kurzem starb ein Student mit 28 Jahren, später eine Mutter von zwei Kindern acht und zehn Jahre alt. Beide wurde vom Lkw übersehen. Das geschah, weil der flüssige Autoverkehr wichtiger war, als die Sicherheit von Radfahrenden.
Und mir wird komisch bei dem Gedanken, wie wir immer noch Landschaften zerschneiden und zerstören. Und was für eine zerstörte Natur wir den Kindern unserer Kinder überlassen. Weil wir gedacht
haben, viele Straßen und viele Autos bedeuten Wohlstand. Weil viele Menschen meinten, dass das etwas Gutes sei, nicht nur für uns, sondern auch für die nächsten Generation. Aber das Gegenteil ist
der Fall.
Inzwischen gibt es nur wenige Bereiche in Deutschland, wo man keinen Verkehrslärm hört. Das ist zumindest in urban Regionen zur Seltenheit geworden. Mehr Verkehr ist verkehrt.
Und ich frage mich, wie ich meinen Enkel erzählen soll, dass sich in ihrem Essen riesige Mengen Micro Plastik befinden. Ein Großteil davon wird durch Reifenabrieb verursacht. Wir wussten das,
haben aber nichts daran geändert. Einfach weiter gemacht, nur halt mit Elektroautos.
Ich habe nichts gegen Autos, aber etwas gegen 50 Millionen Privatautos, ich nenne sie Intimautos. Denn eine Ursache des Problems ist, dass jeder meint, ein eigenes Auto besitzen zu müssen; ich
habe ein Problem damit, dass wir nicht intelligent genug sind, unsere Autos gemeinsam zu nutzen, selbst wenn es noch so perfekt organisiert ist, selbst wenn es günstiger ist, wenn es einfacher
ist.
Stellen wir uns vor, dass nur ein Viertel der Autobesitzenden in Deutschland, von ihrem Intimauto zu Carsharing wechselt. Stellen wir uns weiter vor, dass für jedes abgemeldete Auto, ein Baum
gepflanzt würde oder eine hochwachsende Hecke oder Sitzmöglichkeiten mit Blumen- und Kräuterbeeten errichtet würden.
In den Städten käme es zu einer enormen Entlastung der Menschen: weniger Lärm, weniger Unfälle, weniger Verletzte, weniger Micro Plastik. Mehr Grün, Aufenthalt und Lebensqualität nicht nur für
Reiche. Das ist meine Vision.
Für mich ist das eine wunderbare Vorstellung, bei der Niemand benachteiligt wird und alle weiterhin die Vorzüge und die Freiheiten des Autos genießen können.
PostPrivatAuto
In Deutschland bekommt man Geld vom Staat, wenn man ein Dieselauto fährt, wenn man pendelt oder wenn man einen Dienstwagen hat. Viele Milliarden gab es zuletzt für den Kauf eines Elektro- oder Hybridautos.
In Marburg gibt es jetzt 1250 Euro Prämie, wenn man ein Auto abmeldet und zum Beispiel CarSharing ausprobiert. Dafür gibt es einen Gutschein im Wert von bis zu 800 Euro. Hinzu kommen 400 Euro in
Form von Marburg-Gutscheinen, die man bei 200 Händlern und Restaurants ausgeben kann. Zudem zahlen wir bis zu 600 Euro für Deutschlandtickets.
Die Reaktionen sind überwältigend positiv. Es gab schon viele Anträge in den ersten Tagen. Mit so einem Ansturm haben wir gar nicht gerechnet.
Aber es gibt auch Kritiker, die sagen, dass hier Steuergelder verschwendet werden. Zudem sei die Umsetzung schwer kontrollierbar, die Wirkung kaum messbar.
Das erscheint mir kaum nachvollziehbar. Der Bund fördert das Autofahren mit jährlich rund 15 Milliarden Euro. Die Wirkung ist eindeutig negativ. Im Jahr 2008 hat der Bund fünf Milliarden Euro
verschenkt, damit die Menschen ihre Autos verschrotten lassen. 2500 Euro hat man dafür bekommen, das nannte sich Umweltprämie. In Marburg bekommt man jetzt die Hälfte davon, wenn man wirklich
etwas für die Umwelt tut und auf CarSharing umsteigt.
Einmal angenommen der Bund würde nur ein Drittel der Autobesitzförderung auf eine Förderung für Mobilität ohne Privatauto verlagern, dann könnten jährlich bis zu vier Millionen Euro Prämie
ausgezahlt werden. Jedes Jahr würden also vier Millionen Autos für mindestens ein Jahr abgemeldet werden.
Ganz freiwillig und ohne Zwang käme es zu einer dramatischen Blechentlastung in den Städten. Das wäre doch fantastisch!
In der Kernstadt von Marburg, das haben Untersuchungen ergeben, steht ein Viertel der Fahrzeuge überwiegend rum. Das ist wenig der überraschend, denn unsere Autos sind Stehzeuge. Sie werden im
Durchschnitt nur eine Stunde täglich genutzt. Repräsentative Befragungen zeigen, dass ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger in den Städten von ihrem Auto sagen, dass sie es eigentlich gar nicht
brauchen.
Für Millionen Menschen ist das Privatauto extrem unwirtschaftlich. Viele Menschen wohnen und arbeiten in der Stadt, fahren viel Rad und nutzen den Wagen kaum. Trotzdem zahlen sie monatlich locker 400 Euro dafür. Warum? Das ist Routine. Das ist unsere Mobilitätskultur.
Rational ist CarSharing für viele Millionen Menschen die besser Alternative, etwas umständlicher zwar, aber mit vielen Vorteilen. Und dennoch tun sich auch Ökos schwer mit dem Wechsel. Mit der
persönlichen Verkehrswende.
Das ändert sich jetzt vielleicht in Marburg.
Automann wird grün
Ein Freund arbeitet in der Autoindustrie und hält nicht viel von E-Autos. Jetzt kommt heraus, dass er offenbar seit Jahren die Grünen wählt - die Kolumne
„Öko-logisch.“
Mein Freund Paul arbeitet in der Automobilindustrie. Seine Firma produziert Ölfilter. Diese werden irgendwann einmal kaum noch für Autos gebraucht. Das Unternehmen
muss nun neue Geschäftsfelder erschließen, um zu überleben.
Mit Paul haben ich viele Jahre über die Zukunft des Automobils diskutiert. Einmal hielt er mir eine (längst überholte) Studie unter die Nase, wonach das E-Auto für
das Klima schädlicher sei als die Dieselstinker. Wie die gesamte Branche hat er sich an jedem Strohhalm festgehalten und den Veränderungsdruck verdrängt.
Vor unserem nächsten Treffen hat er angekündigt, es gebe Neuigkeiten. Ich war gespannt wie Flitzebogen. Keine Ahnungen, was das sein könnte. Dann die Überraschung:
Paul ist nunmehr Mitglied bei den Grünen!
Darauf wäre ich nicht gekommen. Ein Automann wird grün? Nun, ich kann gar nicht sagen, dass er sich gar nicht für Umweltschutz interessiert hat. Aber insgesamt, konnte man nicht den Eindruck gewinnen, dass das Thema Klimaschutz einen großen Stellenwert in seinem Leben hat.
Ehrlich gesagt habe ich mich auch nie wirklich gefragt, welche Partei mein Freund in der Regel wählt. Offenbar war das in unseren Gesprächen nicht offensichtlich. Klimaschutz fand er immer wichtig, grüne Politik hat er kritisch hinterfragt. Er hätte also auch dem grünen Flügel der CDU angehören können.
Aber nun kommt raus, er habe eigentlich schon immer grün gewählt. Aha. Und warum jetzt die Mitgliedschaft in der Partei? Immer liegt der Mitgliedsbeitrag in der Regel bei ein Prozent des Nettoeinkommens. Seine Begründung hat mich beeindruckt. Er sähe seinen Eintritt als Statement gegen die aggressive „alle gegen Grün“ Stimmung. Dass Friedrich Merz die Grünen zum Hauptgegner erklärt habe, sei ein fataler Fehler gewesen. Der Hauptgegner sei die AfD. Dass die Grünen Reformer von allen Seiten angegriffen würden, fand er gefährlich. Insbesondere die persönlichen Angriffe auf grüne Politiker, etwa indem man ihnen den Weg versperrte.
Jetzt sei die Zeit Farbe zu bekennen. Statt über Grüne und grüne Politik zu schimpfen, sollten Menschen, die den Wandel in eine zukunftsfähige Wirtschaft gestalten wollen, Unterstützung erfahren. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dem Paul ein Mitgliedsformular der Grünen auszuhändigen. Musste ich auch nicht. Er ist von ganz allein darauf gekommen.
Der Verkehr kommt dann schon....
Was mich immer wieder deprimiert, ist der fortschreitende Aus- und Neubau von Straßen. Und deswegen drängt es mich immer wieder darüber zu schreiben. Während es bei der Energiewende inzwischen
richtig vorangeht, verschlimmert sich die Lage im Straßenverkehr. Mehr Autos, mehr Lkw, mehr Kilometer, mehr Spritverbrauch, mehr Klimagase, mehr Schadstoffe, mehr Mikroplastik. Durch die
zunehmende Zerschneidung der Landschaften werden Zonen ohne Lärm immer kleiner. Zentrale Ursache dieser Entwicklung ist der Ausbau des Straßennetzes.
Dass zusätzliche Straßen, mehr Verkehr mit sich bringen ist kein Mythos, sondern Fakt. Doch die meisten Politiker scheinen das zu verdrängen, wie Donald Trump den Klimawandel.
Und wie ist das bei den Experten im Bundesverkehrsministerium? Sind die dumm und ignorant? Wohl kaum. Wie erklärt sich dann, dass man einfach weiter plant und baut, als gäbe es kein Morgen
mehr?
Die für Verkehrspolitik Verantwortlichen begrüßen in ihrer breiten Mehrheit auch Verkehrswachstum, denn damit geht ja schließlich wirtschaftliches Wachstum einher. Gewiss, da sind die oben
genannte Probleme mit dem Natur- und Klimaschutz. Aber offenbar scheinen diese Probleme den Verkehrsexperten im Bund und Land weniger am Herzen zu liegen als das Wirtschaftswachstum.
Nur grüne Politiker stellen das Verkehrswachstum grundsätzlich in Frage.
Ansonsten sehe ich krasse Widersprüche zwischen Postulaten und Taten: In der Kommunalpolitik begegnen mir in breiter Mehrheit Menschen, die den Verkehr begrenzen, ja sogar verringern wollen und
zugleich den Ausbau von Straßen und Neubaustrecken befürworten. Da wird das Problem der Verkehrszunahme geleugnet und verdrängt. Da wäre man dann doch wieder beim Trump-Stile.
Ja aber werden jetzt einige erwidern, die neue Umfahrungsstraße dient doch der Entlastung. Sie führt zu weniger Verkehr! Nein, das hat es noch nie gegeben. Die Umfahrung führt zu Beschleunigung
und die mündet immer in mehr Verkehr. Meist verpufft sogar die Entlastung einer Wohngegend nach einigen Jahren.
Ich erinnere mich gut an einen Schlagabtausch im Kommunalparlament. Es ging um die Frage, wie großzugig eine Straße ausgebaut werden sollte, die zwei Stadteile durch ein Wohngebiet verbindet.
Eine schmale Wohnstraße mit Tempo 30 hätte die Probleme klein gehalten. Die breite Version mit Tempo 50 würde den Verkehr zwischen den Stadteilen anschwellen lassen. Die Grünen wurden überstimmt.
Eingeprägt hat sich bei mir der abschließende Satz zur sozialdemokratischen Begründung der Asphaltmaximalversion: »Der Verkehr kommt dann schon!«.
Wirtschaft neu denken
»Das Gute darf wachsen, das Schlechte muss schrumpfen«, so hat es Wolfgang Sachs einmal treffend zusammengefasst. Die Wachstumsdebatte krankt mitunter daran, dass einige Kritiker das Wachstum als solches problematisieren. Dabei ist erfolgreicher Klimaschutz nicht ohne Wachstum bestimmter Sektoren möglich.
Doch ist es plausibel, aus ökologischen Gründen eine Schrumpfung der Wirtschaft zu fordern? Wo es hinführt, wenn die Wirtschaft schrumpft, lässt sich sehr gut in Krisenzeiten beobachten. Jobs
gehen verloren, Steuereinnahmen sind rückläufig, die Sanierung von Schulen wird verschoben, es gibt keine Rentenerhöhung, sondern Kürzungen, es fehlen die Mittel für den Ausbau der Bahn, von
Radwegen und vielem mehr.
Wirtschaftskrisen wirken sich zwar meistens positiv für den Klimaschutz aus. Aber die Menschen leiden, wenn man beispielsweise an die Finanzkrise und die Folgen etwa für Griechenland und Spanien
denkt. Schrumpfung, zumal eine unkoordinierte, ist keine Lösung.
Einmal angenommen, es geschähe, was geschehen müsste. Häuser würden nur noch aus Holz oder anderen naturverträglichen Materialien gebaut. Wie viele Jobs gehen da bei den Zementwerken in der
Zementindustrie verloren und wie viel würden auf der anderen Seite in der Holzindustrie, Waldwirtschaft, Sägewerken, Zimmerei und so weiter entstehen? Welche Transferpotenziale gibt es zwischen
beiden Arbeitsmärkten? Können also Beschäftigte aus einem Zementwerk in ein Sägewerk wechseln?
Carsharing ist für die deutsche Autowirtschaft ein Alptraum. Würde die Vision einer Mobilitätswende real und, sagen wir mal nur noch 30 Millionen statt wie jetzt 50 Millionen Pkw herumstehen,
wäre das wohl nicht so erfreulich für die Hersteller in Deutschland. Lassen sich die Stellenverluste durch neue Jobs im öffentlichen Nah- und Fernverkehr auffangen?
Die Stromerzeugung aus Kohle und Gas muss schrumpfen. Bis vor einigen Jahren haben noch viele Lobbygruppen behauptet, das funktioniert nicht. Doch es kann sein, dass sich diese Schrumpfung
durch Wachstumsbranchen wie Solare Stromerzeugung und moderne Heizungen ausgleichen lässt.
Manche Dinge müssen schrumpfen: Plastikmüll, Strom aus Steinkohle und Braunkohle, die Zahl der Pkw, Verbrennungsmotor, Parkplätze, Nationalismus, Einsatz von Pestiziden.
Vieles sollte nicht wachsen: Flugtaxi, Hyperloop, Weltraumtourismus, Ausbau von Flughäfen, Straßenbau, Streaming, Logistikzentren, Gewerbe- und Büroflächen
Und für viele Sektoren ist Wachstum wünschenswert: Ökologische Landwirtschaft, Produktion von Fahrrädern, Rollern, E-Autos, CarSharing, BikeSharing, DeskSharing, Reparaturwesen,
Ersatzteilvorhaltung, Mehrwegsysteme und Pfandflaschen, Regionale Ökonomie, lokale Produktion, Pflege, Medizin, Bildung, Gemeinschaft und soziale Sicherheit.
Klingt doch gar nicht schlecht, oder?
Mein Leben mit der Bahn
Kurz vor Weihnachten hat sich meine Tochter aus Nürnberg auf den Weg gemacht. Sie wollte rauf in den Norden Deutschlands. Um 16 Uhr ging der Zug, um 21 Uhr war sie wieder in Nürnberg. Kein Durchkommen wegen Sturm. Am nächsten Morgen weiter Chaos. Jana selbst, aber auch Freunde und Familie waren frustriert. Was für eine Zeitverbrennung. Ich möchte gar nicht ausführen, welches Hin und Her, Auf und Ab der Hoffnungen und Erwartungen mit dem Bahnchaos einhergehen. Aber: Kein Gejammer über die Bahn. Das ist langweilig.
Herbstlärm: Laubpuster verbieten?

Moral und Ohnmacht

Wer sein Auto liebt, kommt schlecht davon los
Bevor ich Dezernent für Klimastrukturwandel in Marburg wurde, war ich viel mit der Bahn unterwegs, um über die Rolle politischer Steuerung beim Klimaschutz zu sprechen. Ich fuhr mit dem Faltrad zum Hauptbahnhof und vom Zielbahnhof weiter mit dem Rad.
In Rheine erklärte ich rund 130 Lehrern, was Ökoroutine für die Bildung heißt. Anschließend kam einer zu mir und sprach davon wie katastrophal die Zugverbindung zwischen Osnabrück und Rheine sei,
weshalb er mit dem Auto fahren müsse. Ich war irritiert, kam ich doch gerade aus Osnabrück mit dem Zug. In meinen Augen ist die Verbindung exzellent – 50 Kilometer in 30 Minuten und die Schule in
Rheine ist nur 100 m entfernt vom Bahnhof . Aber sicher, von Tür zu Tür ist man mit dem Auto – ohne Stau – etwas schneller.
In solchen Momenten frage ich mich, ob man solche Menschen jemals davon überzeugen kann, die Umstände des Nahverkehrs auf sich zu nehmen. Sie lieben anscheinend ihr Privatauto. Bus und Bahn sind
demgegenüber einfach nur ätzend. [Statt das offen zu bekennen, schimpft man lieber über das schlechte Angebot.]
Mich stört, dass permanent erklärt wird, wie schlecht der Nahverkehr sei und eigentlich nie, was gut funktioniert. Wenn die Behauptung stimmen würde, dass die Leute schon mit Bus oder der Bahn
fahren würden, wenn das Angebot stimmt, dann wäre die Mobilitätswelt eine andere.
Automobile Menschen ändern ihre Gewohnheiten leider nicht, nur weil eine gute Busverbindung vor dem Haus startet. Sie nehmen ein gutes Angebot nur aufgrund von finanziellen Anreize an. Als mit
Kriegsbeginn die Preise explodiert sind, da haben viele etwas Neues versucht. Zugleich ist es wichtig, dass Arbeitnehmer etwas für ihren Parkplatz bezahlen. So zwei bis drei Euro pro Tag würden
fürs erste schon ein guter Anreiz sein.
Im Gegenzug sollten die Arbeitgeber ein Job- oder Deutschlandticket sponsern. Bei solchen Voraussetzungen, so zeigt die Erfahrung, dass zumindest solche Menschen, die über gute Alternativen
verfügen, mehr und mehr in Erwägung ziehen, diese zu nutzen.
Die Verkehrswende wird in den Städten ihren Anfang nehmen, dort wo die Alternativen optimal verfügbar sind. Und sie setzt bei denen an, die nicht – insbesondere aus gesundheitlichen Gründen –
auf’s Intimauto angewiesen sind.
Heiliger Konsum
Der Drang nach Markenprodukten kann mitunter einem religiösen Zwang ähneln. Wirklich cool ist aber was ganz anderes: sich unabhängig machen vom Marken-Fetischismus.
Mich nervt die Angeberei mit Marken. Besonders auffällig ist das bei Kleidung. Ein T-Shirt kostet gleich 50 Euro mehr, nur weil es von Boss ist oder Tommy Hilfiger. Fürst von Metternich mag ein
guter Sekt sein, aber ich schätze mal, fünf Euro pro Flasche bezahlt man alleine für die Marke bzw. für die Werbung, die dahintersteckt.
Die deutsche Industrie investiert über 34 Milliarden Euro in Werbung. Damit wir Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Damit wir schuften, um zu schoppen. Und damit wir viel mehr
Geld für angesagte Marken ausgeben als für faire Produktionsbedingungen.
Wenn Leute teure Marken tragen, denke ich mir, der muss gut bei Kasse sein. Und Menschen, die wohlhabend wirken, müssen ja auch irgendwie erfolgreich sein, oder? Zumindest neigt man zu dem
Gedanken. Ich weiß aber auch: Sehr viele Menschen mit viel Geld haben nicht im Geringsten etwas Bedeutendes geleistet. Schon gar nicht für die Gemeinschaft.
Doch nicht nur Topverdiener und Erben versuchen, mit Marken und Produkten auf sich aufmerksam zu machen. Ich habe mich selbst auch schon öfter dabei erwischt. Natürlich wollte ich mir das nie
eingestehen. Aber tatsächlich lasse ich mich durch »gute Marken« blenden. Dabei weiß ich rational, dass nicht allein die Qualität eines Produktes zum »Markenbewusstsein« führt, sondern vor allem
millionenschwere Marketingkampagnen.
Einmal zur Weihnachtszeit sah ich einen fetten SUV unter einem festlich beleuchteten Carport. Ich war verwirrt. Warum beleuchtet dieser Mann sein Auto, als wäre es ein Heiligtum? Nun, Konsum hat
ja mitunter religiösen Charakter. Aber erst nach einer Weile wurde mir der Grund für die Illumination klar. Dieser Mann ist auf der Suche nach Liebe und Anerkennung.
Weniger MIV fördert den Umsatz

Gesetzliche Standards, statt TechBoyFantasien
Der Begriff »Technologieoffenheit« ist durch die FDP zu einer »wird schon alles gut« Formel verkommen. Irgendwie, irgendwo irgendwann wird es viele schöne Dinge geben, die unsere Probleme lösen. Im Kern heißt das doch, macht euch nicht verrückt wegen der Klimahitze. Wir, also Leute mit viel Geld, können uns doch Klimaanlagen leisten!
Die beschworenen E-Fuels, das hatte ich schonmal beschrieben, werden auch nur etwas für Leute mit richtig viel Knete in Frage kommen und durch den irren Strombedarf, die Kosten für alle anderen
erhöhen.
Ja, es stimmt, die vermeintlich liberalen setzten auf Emissionshandel. Das ist im Kern auch ein kluges Instrument. Nur führt es eben auch dazu, dass die Preise für Strom, Sprit und für's Heizen
steigen. Das möchte die FDP allerdings auch nicht wirklich, weshalb sich Lindner für einen Tankrabatt eingesetzt hat.
Parallel zu moderat steigenden CO2-Preisen brauchen wir daher gesetzliche Standards. Das geplante Gesetz für Heizungen ist für die Kommunalpolitik ein Segen. Ich habe keine Ahnung, wie die Städte
sonst ihre Klimaziele einhalten könnten. Denn von allein findet der Wandel nicht statt. Notwendig sind Impulse, in Form von gesetzlichen Rahmenbedingungen, gerne flankiert durch Fördergelder.
Die Gaskrise war ein Treiber für die Installation von Wärmepumpen. Dieser Effekt würde aber sehr schnell wieder verpuffen, wenn die Preise sich normalisiert haben. Wir brauchen solche
gesetzlichen Standards.
Wenn eine Technologie gut funktioniert, erprobt und gut verfügbar ist, dann sollten wir sie zu Norm machen, wie das bei den Heizungen übrigens schon andere Länder längst gemacht haben. Weil der
Bund diese Entwicklung verpennt hat, hinken unsere Handwerker hinterher, beraten bis heute für eine Gasheizung. Viele tun das einfach, weil sie von der neuen Technik, die übrigens ziemlich alt
ist, gar nichts verstehen, weil sie keine Ausbildung haben.
Ähnlich war es auch bei den hoch effizienten Heizungspumpen. Das Wuppertal Institut nannte sie »die Faktor-4-Pumpe«, weil sie viermal effizienter war als ein herkömmliches Gerät. Nur, die meisten
Handwerker hat das nicht interessiert. Selbst als der Bund die Pumpe finanziell gefördert hat, meinten viele, »lohnt sich nicht« und verbauten scheinbar billige Stromfresser mit einem Verbrauch
von 800 Kilowattstunden im Jahr.
Irgendwann hat die EU und damit auch der Bund, die effizienten Geräte zur Norm gemacht. Die Handwerker konnten schlichtweg keine Verschwender mehr kaufen. Niemand hat sich darüber aufgeregt, auch
weil die Standards schrittweise angehoben wurden. Wir sollten offen sein für neue Technologien und sie nach eine gewissen Einführungsphase zur Norm erheben.
Verkehrsminister BrummBrumm will mehr Straßen. Für was eigentlich?

Bild und die Ölheizung
»Sanierungs-Zwang und neue Heizung. Das kostet Sie der neue Wohn-Hammer« heißt es auf dem Titelblatt der Bild. Ich frage mich, warum Bild Lobbyarbeit für die Gasindustrie betreibt.
Wer jetzt eine neue Öl- oder Gasheizung installiert, finanziert damit für die nächsten zwanzig Jahre Despoten, die uns nichts Gutes wünschen und ihr Volk unterdrücken. Warum verunsichern Bild und FDP die Eigentümer von Immobilien? Beide wecken den Eindruck, dass im nächsten Jahr alle fossilen Heizungen gewechselt werden müssen.
Doch die geplante Verordnung zielt darauf ab, dass Monteure ab dem Jahr 2024 nur noch besonders klimafreundliche Heizungen installieren. Das heißt, der Wandel kommt
nicht plötzlich. Sehr alte Heizungen kündigen über die häufiger werdenden Reparaturen ihr schleichendes Ende an.
Zugleich sind Wärmepumpen voll im Trend. Die Installation hat sich seit 2017 verdreifacht. In Kombination mit den Fördergeldern des Bundes machen sich die Menschen unabhängig von Russland.
Ich bin übrigens ein großer Freund von steigenden Standards. In meinem Konzept der „Ökoroutine“ sind diese zusammen mit Limits der Rote faden für den Ansatz
„Strukturen ändern Routinen“. Die zurückliegenden Fortschritte beim Klimaschutz gründen auf einer Politik der steigenden Standards, welche sich letztlich in Verordnungen niederschlagen. Häuser,
Autos und Elektrogeräte wurden effizienter aufgrund von Regelwerken, nicht aus Altruismus.
Neben Standards benötigen wir Limits, also absolute Obergrenzen, etwa für den Luftverkehr oder den Bau von Straßen. Dieses Instrument wird bisher nur selten
angewandt. Sie sind jedoch notwendig, Wachstumstendenzen zu begrenzen, die zerstörerisch wirken. Ganz einfach eigentlich.
Reine Förderanreize wirken zu langsam, manchmal gar nicht. Sie sind für Innovationen angemessen, deren Marktdurchdringung noch nicht gesichert ist. Bei erprobten
Technologien wie einer Wärmepumpe ist es effektiver, diese als Norm festzulegen. Von allein tut die Industrie das nicht, leider. Es ist der EU-Kommission zu verdanken, dass sie beispielsweise das
Steckerwirrwar für Mobiltelefone beendet hat. Die Hersteller habe sich nur auf Druck geeinigt. Anreize allein wirken zu langsam und ineffizient. Das E-Auto wird sich nicht durch Fördergelder
durchsetzen, sondern durch Vorgaben der EU.
Verordnungen, wie das geplante Gesetz zum klimafreundlichen Heizen, sind ein zentraler Innovationstreiber und geben die Richtung vor. Hinzu kommt klimafreundliche
Technologie. Das ist die Verantwortung der Politik.
Mal ganz ehrlich, ich bin froh, dass viele Schadstoffe in Lebensmitteln verboten sind und, dass in meiner Wohnstraße verboten ist, schneller als 30 km/h zu fahren.
Der Wohn-Hammer ist ein Wendehammer. Er wird den Menschen viel Geld sparen und dafür sorgen, dass sie das gute Gefühl haben, mit ihrer neuen Heizung einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Mein Wechsel in die Praxis
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
seit dem 1. August 2022 bin ich Stadtbaurat in Marburg – in Langform: »Dezernent für Klimastrukturwandel, Bauen, Stadtplanung und Mobilität«. Für die Zeit der Amtsperiode von sechs Jahren hat mich das Wuppertal Institut beurlaubt. Der Wechsel in die Praxis hat mich viel Überwindung gekostet. Meine Freiheiten als Wissenschaftler, Buchautor und Referent waren mit Amtsantritt schlagartig beendet. Das Wort zur Ökoroutine weiter zu betreiben, erschien kaum möglich. So viel Verantwortung, so viel zu lernen.
Es war die richtige Entscheidung, das kann ich mit Gewissheit sagen. Meine Zeit als Ratsmitglied in Osnabrück war die ideale Vorbereitung auf die Aufgaben als Dezernent. Ich kann viel besser als erwartet, Konzepte und Ideen umsetzen, die mir wichtig erscheinen. Viele kreative und innovative Menschen arbeiten in meinem Dezernat, aber auch in der gesamten Verwaltung. Mir begegnen in Marburg viele Menschen, die ihre Stadt beim Klimaschutz voranbringen wollen.
Ich möchte nun wieder gelegentlich einen Beitrag in den Blog stellen.
Zu meinen ersten Eindrücken als Dezernent in Marburg gibt es inzwischen zwei Interviews. Einmal auf Marlows: »In urbanen Räumen brauchen Menschen kein eigenes Auto« und in der Lokalzeitung Oberhessischen Presse: »Was Marburgs oberster Klima-Kämpfer will«. Aus den Berichten hebe ich diesen hervor: Kühles Klima. Kopatz kontra Kaufleute
Letztlich drehen sich alle Texte um dasselbe Thema: Strukturen und Rahmenbedingungen ändern, damit sich Routinen und Gewohnheiten wandeln; mit anderen Worten um Ökoroutine.
E-Fuels sind ungerecht
E-Fuels sind ein Treiber für Gegeneinander und Ungleichheit. »Die da oben, wir hier unten«, das denken sich jetzt schon viele Menschen. Es geht nicht nur um die reale, sondern um die empfundene
Ungleichheit. Der exzessive und für jedermann sichtbare Lebensstil von reichen Menschen schürt Neid.
Rund ein Drittel der Gesellschaft kann sich nicht ohne
Weiteres eine neue Waschmaschine kaufen, wenn die alte gerade kaputt gegangen ist, weil keine Ersparnisse vorhanden sind.
Auf der anderen Seite haben wir Top-Verdienende und Erben, die sich einbilden, ihren Luxus »verdient« zu haben. Weil sie ja so leistungsstark sind, so unfassbar produktiv. Und deswegen ist es
auch angemessen, dass für diese Menschen E-Fuels produziert werden. So sieht das offenbar die FDP.
Mit E-Fuels kann man zwar einen konventionellen Motor klimaneutral betreiben, aber nur wenige Menschen werden sie bezahlen können.
Was ist das überhaupt für eine Wundertechnologie? Ein Elektrolyseur zerlegt Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff. Ein häufiges Experiment im Schulunterricht. Der Wasserstoff
wird mit CO2 angereichert. Das CO2 müsste wiederum irgendwo abgespalten oder gesammelt werden. Das Ergebnis sind E-Fuels – synthetisches Gas oder flüssiges Benzin, Diesel oder Kerosin. Für
heutige Motoren sind diese nur als Beimischung verträglich. Neufahrzeuge müssten speziell dafür ausgelegt werden. Das ist die liberal klingende Technologieoffenheit.
Der Haken: Um Kraftstoff für 100 Kilometer zu produzieren werden Unmengen Strom benötigt. Ein Elektrowagen würde mit derselben Stromleistung rund 700 Kilometer weit kommen.
Es gibt offenbar gute Gründe, weshalb zum Beispiel VW auf Elektroautos setzt. Die Ingenieure sind sich im Grunde einig, dass E-Fuels am ehesten für Flugzeuge und Lkw zum Einsatz kommen werden.
E-Fuels werden durch den hohen Stromeinsatz sehr teuer sein. Wer kann, der kann – in 15 Jahren mit einem Verbrenner wunderbar den privaten Wohlstand zur Schau stellen. Ganz liberal und fair.
Doch der Kraftstoff ist nur klimaneutral, wenn die Stromerzeugung mit Ökostrom erfolgt. Schon jetzt geht der Ausbau von Solaranlangen nur mühselig voran. Windparks treffen auf Widerstand bei den
anliegenden Bewohnern. Der Import gewaltiger Mengen Ökostrom oder Ökowasserstroff aus südlichen Ländern ist in naheliegender Zeit nicht realistisch. Warum, das habe ich im Blog
vom 1. Mai 2022 erläutert.
Nach und nach sollen alle Autos elektrisch betrieben werden. Dafür muss noch viel mehr Ökostrom erzeugt werden. Die Nachfrage steigt und das Angebot kann damit kaum mithalten. E-Fuels werden
diesen Effekt verstärken.
Einmal angenommen, eine Millionen Autos sind mit E-Fuels unterwegs. Dafür müsste dieselbe Strommenge erzeugt werden, wie für sieben Millionen normale Elektrowagen. Das heißt, E-Fuels verknappen
das Angebot und werden Strom teurer machen. Denn die verfügbare Strommenge bleibt auf absehbare Zeit begrenzt und die Nachfrage steigt – schließlich müssen wir sobald als möglich auch noch unsere
Wohnungen mit Ökostrom heizen. Und damit werden auch Millionen Menschen mit geringem Einkommen mehr ausgeben müssen für Strom. Deswegen fördern E-Fuels die Ungleichheit.
Vom 9-Euro zum Klimaticket
Seit Monaten diskutiert die Öffentlichkeit über das Billig-Ticket, aber die eigentliche Innovation wird dabei nicht erwähnt. Das Ticket ist nicht nur besonders billig, sondern es ist ein Testlauf
für den Einheitstarif. Der Fahrschein gilt in Berlin, Hamburg und Heidelberg gleichermaßen. Es wäre eine Sensation, wenn unsere Verkehrspolitiker:innen das hinbekämen. Ein Fahrschein oder
Abonnement für alle Städte zum selben Preis.
Bisher hat jede Region ihre eigene Tarifstruktur. Da verbringen die Leute schonmal fünf bis zehn Minuten vor dem Automaten, um den günstigsten Tarif zu ermitteln. In einer Großstadt kann man
schon eine Weile grübeln, ob Kurzstrecke, Einzelfahrschein, Viererstreifen, Tagesticket, Tagesticket ab 9 Uhr, Familienticket usw. am günstigsten ist. Ähnlich vielfältig sind Monatstickets:
PremiumAbo, BasisAbo, 63plusAbo, MobilAbo, BasisAbo Region, JobTicket. Das macht einen doch wuschig.
Gut 50 Euro kostet der Basistarif in einer Stadt mit 150 000 Einwohner monatlich. Wer vom Landkreis mit dem Bus in die Stadt pendeln möchte liegt schnell bei 100 Euro. Richtig teuer wird es, wenn man ein Tarifgebiet verlässt.
Nun also kommt ein Flatratetarif für sage und schreibe neun Euro. Der Tarifdschungel lichtet sich für drei Monate. Ein Tarif für alle Städte, das ist klar und transparent. Versteht jeder.
Doch wüsste ich gern warum das 9-Euro-Ticket so billig ist. Und warum muss es deutschlandweit gelten? Schon allein für eine Stadt wie Göttingen wären neun Euro ein Spottpreis. Warum nicht 30 Euro
pro Monat? Oder anders gefragt: Warum hat man nicht versuchsweise für ein Jahr das Konzept aus Österreich umgesetzt?
Dort gibt es ein Klimaticket in drei Stufen. Für ein Bundesland kostet es 365 Euro, der doppelte Preis gilt für zwei Länder und der dreifache für ganz Österreich. Die BahnCard 100 kostet damit
1095 und mit Ermäßigung 821 Euro pro Jahr. In Deutschland zahlen die Kunden 4144 Euro. Das lohnt sich nur für Menschen, die mehrmals pro Woche verreisen oder lange Strecken pendeln. Vor der COVID
Krise gab es nur knapp 50 000 Inhabende.
Den hohen Preis begründet die Bahn mit dem großen Netz. Nach dieser Logik müsste das Monatsticket aus Berlin allerdings mindestens zehnmal teurer sein als in Braunschweig. Das ist aber nicht der
Fall, weil die Kosten bezogen auf den Kunden in beiden Städten recht nahe beieinander liegen. Ein Vergleich der Ausgaben pro Einwohner zeigt, dass Österreich sogar deutlich mehr ausgibt als Deutschland. Die
BahnCard 100 müsste dort demnach deutlich teurer sein. Doch stattdessen lockt die ÖBB neue Kunden mit einem einfachen und enorm günstigen Tarif an.
Ganz so simpel ist das nun nicht, werden Experten für öffentlichen Verkehr einwenden. Stimmt. Aber die Grundkonzeption aus Österreich ist bestechend einfach, günstig und transparent. Es ist
zugleich eine Einladung, das Privatauto öfter stehen zu lassen oder gar abzuschaffen.
So gesehen ist das 9-Euro-Ticket womöglich der Einstieg in eine Diskussion über die Einführung eines 1-2-3 Klimatickets nach dem Vorbild aus der Alpenregion. Schön wäre es.
Das eigene Auto bremst die Mobilitätswende aus
Ich kenne sehr viele Menschen, die sich einen großen Teil ihrer Freizeit für den Klimaschutz engagieren. Besonders das Thema Verkehr brennt fast allen auf den Nägeln. Sie wollen weniger Autos in der Stadt und mehr Platz für Radwege, Aufenthalt und Grün.
Zugleich gibt es unter diesen Engagierten kaum jemand ohne eigenes Auto. Offenbar fällt es selbst Klimaschutzaktivisten schwer, sich davon zu trennen. Das wäre aber notwendig, wenn die Vision von der autofreien Innenstadt Wirklichkeit werden soll.
Darauf angesprochen nennen Autobesitzter natürlich viele Gründe, weshalb sie darauf angewiesen sind. Und, dass ihr Fahrzeug inzwischen eigentlich ein Stehzeug sei. Man würde es kaum noch benutzten. Kein Problem also?
Doch, die Herstellung belastet das Klima und verschlingt enorme Mengen Ressourcen. Zudem stehen für jeden Pkw ca. drei Parkplätze zur Verfügung. Vor der eigenen Haustür, vorm Supermarkt beim Arbeitgeber. Und mit jedem Gebäude kommen weitere dazu.
Das Intimauto ist ein ökologisches Problem, auch wenn wir wenig damit umherfahren.
Aber was ist eigentlich »wenig«? Das ist natürlich relativ. Ein Kollege sagte mal über sein Auto »das nutzten wir eigentlich gar nicht«. Ich habe mich dann erkundigt, wieviele Kilometer da so zusammenkommen. Er schätzte so rund 10 000 Kilometer pro Jahr. Ganz schön viel für wenig.
Und das hat seinen Grund. Denn ein Wagen der vor der Tür steht ist enorm verlockend. Eben mal einkaufen, eben mal zum Baumarkt, die Kinder wegbringen, abholen etc. Eben mal. Kostet ja kaum etwas.
Raumfahrt für Millionäre
Fortschritt durch Technik. Für den Weltraumtourismus verbrennen der britische Unternehmer Richard Branson und SpaceX-Gründer Elon Musk Milliarden. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos ist auch dabei und
meint damit »eine Zukunft zu ermöglichen, in der Millionen Menschen im Weltraum leben und arbeiten, zum Wohl der Erde«. Die irre Verschwendung soll also auch noch zu etwas gut sein. Wenn
das Leben auf der Erde kaum noch erträglich ist, können sich die Hyperreichen ins Weltall flüchten.
Viele Menschen in Logistikzentren, am Steuer von Lkws und an Fließbändern müssen hart arbeiten, damit sich die Herren Supermilliardäre eine solche Spielerei leisten können.
Wer etwa bei Amazon zwischen den Regalen herumhetzt, kontrolliert und angetrieben, bekommt 12 Euro die Stunde. Da kommt am Ende des Monats abzüglich Steuer und Warmmiete kaum mehr zusammen, als mit Hartz IV.
Deutlicher kann man nicht zeigen, wie ungerecht Einkommen und Vermögen auseinander liegen. Dort die Verschwendung, hier der Kampf ums Überleben.
Da in einer Weltraum-Kapsel wie bei Bezos gerade einmal vier Weltraumtouristen sitzen, kommen auf jeden Fahrgast rund 75 Tonnen CO2 - für knapp zehn Minuten Schwerelosigkeit. Zum Vergleich: Ein
Bundesbürger emitiert jährlich durchschnittlich zehn Tonnen CO2.
Zur enkeltauglichen Mobilität werden Raumfahrtprogramme also wohl kaum beitragen. Vielmehr könnte sich der Eindruck verfestigen, unsere Wirtschaftsordnung dient hauptsächlich den Superreichen.
Der Frust bei den Menschen ohne Vermögen wird zunehmen wie auch der Zweifel, dass es gerecht zugeht in unsere Demokratie.
Atomkraft. Nein Danke?!
Es gibt viele Bedenken in Hinblick auf die Sicherheit der Atomkraft und die Probleme beim Rückbau und der Endlagerung. Doch was ganz entscheidend gegen Strom aus Atomreaktoren spricht: Er ist viel zu teuer. Die Grafik veranschaulicht: Atomstrom ist nicht günstig; Wind- und Solarstrom hingegen schon. Die Diskussion über eine Renaissance der Atomkraft hat sich damit erledigt. Wer sich mit diesem Wort zur Ökoroutine zufrieden gibt, kann jetzt abschalten.
Widerwerbung
Mich nervt die Angeberei mit Marken. Besonders auffällig ist das bei Kleidung. Ein blödes T-Shirt kostet gleich 50 Euro mehr, nur weil es von Boss ist oder Tommy Hilfiger. Fürst Metternich mag ja ein guter Sekt sein, aber ich schätze mal, fünf Euro pro Flasche bezahlt man alleine für die Marke bzw. für die Werbung die dahinter steckt.
Ist ja alles bekannt, aber die Leute machen trotzdem mit. Ich auch, lass mich beeindrucken. Denke, die muss ja ganz schön viel Kohle haben. Manchmal denke ich auch, der scheint es ja nötig zu
haben.
Ich habe mich selbst auch schon öfter dabei erwischt, dass ich mit Produkten beeindrucken möchte. Natürlich will man sich das nicht eingestehen, aber wenn man ehrlich zu sich selbst ist....
Bei meinem Notebook jedenfalls, habe ich schon vor zehn Jahren den Apfel abgeklebt. Das ist eigentlich eine nette Anti Konsum Strategie. Ich bin doch keine Litfaßsäule für Konzerne. Gerade habe
ich bei der Winterjacke das Label überklebt.
Was ich auch bewerkenswert finde, dass die Tageszeitung auf den Fotos im Sportteil, die Werbung auf den Trikots von Fußballspielern verpixelt. Wow! So etwas kann sich vermutlich nur die taz
leisten, die auf Anzeigen von Konzernen nicht angewiesen ist.
Die deutsche Industrie investiert über 34 Milliarden Euro in Werbung. Damit wir Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Damit wir schuften, um zu schoppen. Und damit wir viel mehr
Geld für tolle Marken ausgeben als für faire Produktionsbedingungen.
Wirtschaft ist mehr!
Mir ist aufgefallen, dass ich im Blog noch gar nicht auf mein neues Buch »Wirtschaft ist mehr!« hingewiesen habe. Vielleicht, weil es kaum etwas mit Ökoroutine zu tun hat.
Interessant ist es für einige Abonnenten des Blogs vielleicht dennoch. Mal kurz reingucken kostet nix, denn es ist kostenlos als pdf verfügbar. Das soll der Verbreitung dienen. Also, bitte gerne weiterleiten.
Woche der Abfallvermeidung oder Abfall vermeiden?
Wuppertal 23.11.2021. Heute erfahre ich, gerade läuft die »Europäische Woche der Abfallvermeidung«. Schon mal davon gehört? Ich auch nicht. Dabei gibt es die »Kampagne« seit 2009 in ganz Europa.
Einmal angenommen, jeder Dritte Einwohner der Union wüsste davon – das wäre ein extrem hoher Wert. Was würde sich dadurch ändern? Nichts.
Es ist reine Symbolpolitik die sagt: »Leute, jetzt strengt Euch doch mal an! Es gibt doch so viele Anleitungen zum plastikfreien glücklichen Leben. Sorgt dafür, dass Verpackungen überflüssig werden!« Solche Kampagnen sind Zeitvergeudung. Rausgeworfenes Geld.
Statt eine Woche der Abfallvermeidung brauchen wir Abfallvermeidung. Ganz konkrete Vorgaben für Hersteller und Händler. Statt an die Vernunft der Konsumenten sollten Kampagnen an die Vernunft der Entscheider in Brüssel und Berlin appellieren.
Das wäre doch mal was, die Ampel-Regierung finanziert Kampagnen, um sich selbst und die Produzenten unter Druck zu setzen.
Stoppt den Wahnsinn der Wegwerfplastikflasche! Macht Recup zum Standard. Verlängert die Garantiezeiten! Macht Vorgaben für Ersatzteile und Reparieren!
Mobilität und Mikroplastik

Flow
Letzte Woche haben wir uns über Bahnfahren unterhalten. Wer häufig Bahn fährt, hat viele Geschichten zu erzählen. Leider sind sie selten komplimentierend für die Bahn.
Aber in einem Punkt waren wir uns auch einig. Konzentriertes Arbeiten ist in der Bahn nicht nur möglich, sondern gelingt oft gerade hier.
Oft bin ich so vertieft und in Gedanken, dass ich alles um mich herum vergesse. Manchmal schrecke ich dann auf, und gucke mich, in der Befürchtung den Bahnhof verpasst zu haben.
Oft vergeht die Fahrt wie im Flug. Lesen und arbeiten, noch dazu so intensiv, das geht halt nur im bequemen Zug (nicht alle sind bequem).
CDU blockiert Stadtumbau
Die Grünen im Bezirksbeirat fordern einen Fahrradstreifen in Stuttgart-Nord. Die CDU ist dagegen, weil das rund 120 Parkplätze kosten würde
So lautet eine typische Meldung in Deutschlands Lokalzeitungen.
Ja, man will die Klimaschutzziele erreichen und ja es gibt zu viel Autos in der Stadt. Aber die konkreten Maßnahmen für Klimaschutz und Stadtumbau, die will man nicht.
Die Herren Laschet und Söder möchten die Erneuerbaren Energien massiv ausbauen, aber an der 10H-Regel wollen die beiden nix ändern. Diese Abstandsregel sorgt dafür, dass in NRW und Bayern quasi keine Windkraftanlagen gebaut werden können.
Man verhält sich damit wie die meisten Bürger:innen: Ihr könnt alles machen, aber nicht vor meiner Haustür! Ganz klassisch: In ein schönes Häuschen am grünen Stadtrand ziehen und später eine Bürgerinitiative gründen, um ein Neubaugebiet in der Nachbarschaft zu verhindern. Dieser egoistische Bürgerprotest ist leider der Normalfall.
Von der Politik sollte man mehr erwarten. Politiker:innen sind es doch, die das große Ganze sehen sollten, die Mobilitätswende und nicht nur die wegfallenden Parkplätze in einer Straße. Oder?
Lüge oder Inkompetenz?

Gespräch mit einem Mitglied des Stadtrates
Frau Peters ist Ratsherrin. Sie findet Klimaschutz sehr wichtig und möchte den Radverkehr fördern.
Ich mache den Vorschlag, den Parkstreifen an einer vierspurigen Ausfallstraße in einen Radweg zu verwandeln. Viele Geschäfte mit großen Parkplätzen liegen an dieser Straße. Der Parkstreifen ist im Grunde überflüssig.
Die Situation an der besagten Stelle ist momentan lebensgefährlich. Es gibt in weiten Teilen gar keinen Radweg.
Peters: »Aber die Parkplätze dort wegnehmen, das kann man den Leuten nicht zumuten.«
Ich: »Aber genau solche Maßnahmen werden nun in vielen Städten umgesetzt. Radfahren muss sicherer werden, auch wenn dabei einige Parkplätze verschwinden«, sage ich.
Peters: »Nee, aber so geht das nicht.«
In dem Gespräch erfahre ich, dass Frau Peters sich niemals ein Elektroauto kaufen würde. Das sei totaler Quatsch, schon allein wegen der Reichweite. Und dann wegen der Kinderarbeit. Außerdem würden mit E-Autos viel mehr Klimagase freigesetzt als mit ihrem Diesel.
Ich frage »Wie sollen sich aus Deiner Sicht die CO2-Emissionen um 40 Prozent verringern bis 2030?« Antwort: »Wer legt denn so ein Ziel fest? Hier geht man doch auf die kleinen Leute los. In den anderen Bereichen kann man doch viel mehr bewirken…..«
Und dann kam noch ein Satz, der mir immer wieder als Gegenargument genannt wird: »Michael, die Leute fahren nunmal mit dem Auto.«
Ich habe dann nichts mehr gesagt. Die Leute können gut verdrängen, auch Politiker sind gut darin. Klimaschutz finden alle wichtig, aber bloß nicht konkret werden. Gut, dass es inzwischen viele junge und auch ältere Menschen gibt, die sich das nicht mehr gefallen lassen wollen.
Muss man das Einfamilienhaus verbieten?
Diese Fragen stellte mir neulich ein Journalist.
Nein, wir müssen das Einfamilienhaus nicht verbieten.
Die CDU, das Flugtaxi und Ikarus
Die CDU betont nun mit ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl die positiven Aspekte des Fliegens und möchte die Entwicklung von Flugtaxis fördern. Wenn ich das höre, denke ich mir: Das darf doch nicht wahr sein!
Aber wundert es mich? Nein. Man gibt sich weiter der Illusion hin, allein mit neuen Technologien lasse sich die Klimahitze bekämpfen.
Seit einigen Jahren erwähne ich in meinen Vorträgen das Flugtaxi. Meistens denken die Zuhörerenden »so ein Quatsch!«. Ich mache dann drei Prognosen.
Erstens: Ihr werdet es nutzen, sobald es verfügbar und bezahlbar ist!
Studien gehen davon aus, dass der Flug zum nächsten Flughafen kaum teurer sein wird als mit dem Pkw. Spätestens dann werden es auch »normale« Leute nutzen. Ich bin davon überzeugt, die meisten Menschen würden ein Kleinflugzeug vor der Haustür parken. Es ist nur eine Frage des Geldes.
Zweitens: Man wird uns das Flugtaxi anpreisen als Lösung der Verkehrsprobleme.
Das machen Andy Scheuer und Dorothee Bär (CDU) schon seit einigen Jahren. Zudem wird man das Propeller-Vehikel als Beitrag für den Klimaschutz darstellen. In einem wdr-Beirag heißt es: »Um die Verkehrsprobleme in NRW zu lösen, könnten Flugtaxis demnächst helfen. Sie sind leise, schnell und emissionsarm.«
Erste Studien zeigen, dass die Flugobjekte auf Strecken unter 35 Kilometern sogar mehr Energie verbrauchten und damit mehr Treibhausgase verursachten als Autos mit Verbrennungsmotoren.
Tatsächlich sind Flugtaxis eine Form der massiven Beschleunigung. Man kommt schneller von A nach B, das ist ja der Witz daran. Und bisher war es immer so, dass Beschleunigung zu mehr Verkehr führt. Wie schon mehrfach in diesem Blog beschrieben, investieren die Menschen ca. 80 Minuten am Tag für Mobilität. Daran hat sich in den letzten hundert Jahren kaum etwas geändert. Aber die Zahl der Kilometer, die wir an dem Tag zurücklegen, die hat beständig zugenommen.
Drittens: Das Flugtaxi wird uns nicht glücklicher machen.
Das Flugtaxi ist ein Symbol für unsere Gier nach immer mehr. Werden wir nie genug haben?
Dädalus warnte seinen Sohn Ikarus, nicht zu hoch und nicht zu tief zu fliegen, da sonst die Hitze der Sonne beziehungsweise die Feuchte des Meeres zum Absturz führen würde. Doch Ikarus wurde übermütig und stieg so hoch hinauf, dass die Sonne das Wachs seiner Flügel schmolz, woraufhin sich die Federn lösten und er ins Meer stürzte.
Ist Deutschland zu klein?!
Interessantes Bild auf dem Cover der Greenpeace Nachrichten. Drastisch. Aber nicht von der Hand zu weisen. Der Bodenatlas von Böll und BUND rechnet vor, dass Deutschland jedes Jahr in anderen Ländern 80 Mio. ha Fläche für seine Agrarprodukte in Anspruch nimmt. Verrückt oder? Wir verbrauchen mehr als das Doppelte der eigenen Landesfläche. Die Konsumierenden sind mit solchen Botschaften meistens überfordert und verdrängen solche Probleme lieber. Verantwortungsvolle Politikerinnen sind gefragt.
Mehr. Mehr! Mehr? Teil 1
Die privaten Haushalte benötigten im Jahr 2018 etwa gleich viel Energie wie im Jahr 1990 und damit gut ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland. Das ist ein Problem für den Klimaschutz. Denn beabsichtigt war eigentlich, dass sich der Strom- und Wärmeverbrauch bei den Menschen daheim deutlich verringert. In ihrem Klimaschutzplan sieht die Bundesregierung eine Reduktion von knapp 70 Prozent bis 2030 vor.
Deswegen hat man die Energiestandards für Neubauten deutlich angehoben und deswegen werden Jahr für Jahr ein Prozent der vorhandenen Gebäude saniert. LED-Lampen und supersparsame Waschmaschinen
sind inzwischen der Normalfall. Warum kommen wir dann nicht zum Weniger?
Das Urteil zur Freiheit
Im heute-journal war es die Top Nachricht: Das Klima-Urteil. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut und danke allen, die sich dafür eingesetzt haben.
Wie der freie Markt einen Bauern in den Selbstmord treibt
Ich lese gerade »Unsere Welt neu denken« von Maja Göpel. Sie beschreibt darin ein Erlebnis beim WTO-Gipfel im mexikanischen Cancún. Dort fand die Konferenz der WTO statt, der Welthandelsorganisation. Minister aus bald 150 Ländern verhandeln hier regelmäßig, um den Welthandel zu befördern. Zölle sind schlecht, Freihandel ist gut, so lautet ungefähr das Credo der WTO. Sie steht für das, was wir unter Globalisierung verstehen.
Das Treffen der Minister wird durch Zäune weiträumig abgeriegelt, um die Protestierenden fernzuhalten. Ein Demonstrant stieg auf den Absperrzaun und rammte sich vor aller Augen ein Messer in die
Brust. Maja war geschockt. Wie verzweifelt muss dieser Mensch gewesen sein.
Der Name des Mannes war Lee Kyung Hae. Er war 56 Jahre alt, ein Bauer aus Südkorea, eine Lichtgestalt für nachhaltige Landwirtschaft. Südkorea ist natürlich auch Mitglied der WTO und hat gewiss
vom Freihandel profitiert, musste aber auch die Grenzen für Rindfleischimporte öffnen. So drückte billiges australisches Fleisch aus Massentierhaltung die Preise. Damit konnte Lee Kyung Hae nicht
konkurrieren. Wie viele andere Landwirte verlor er seinen Hof und sein Land an die Bank. Immer wieder habe Lee Kyung Hae auf das Schicksal der Bauern aufmerksam gemacht, schreibt Maja. Sein
Selbstmord vor den Augen der Presse war seine letzte Verzweiflungstat, um auf die Missstände hinzuweisen.
Umwelt- und Sozialstandards werden durch die WTO so gut wie gar nicht reguliert. Ich spreche mich ja regelmäßig für höhere Standards aus. Um diese durchzusetzen – weltweit – wäre die WTO der
ideale Ort. Theoretisch.
Es ist leider so, dass unbegrenzter Freihandel nicht grundsätzlich und für alle gut ist. Es gibt zig Beispiele dafür, dass in manchen Ländern ganze Branchen absterben, wenn es immer nur um
»möglichst billig« geht. Und deswegen finde ich es gut, dass TTIP nicht verabschiedet wurde. Und auch CETA oder Mercosur sind aus meiner Sicht nur zu befürworten, wenn diese Abkommen sozial
gerecht sind und höhere Standards für den Umweltschutz durchsetzen.
Klimakiller Zement und Einfamilienhäuser
Heute nehme ich einen »Bericht« der heute-show zum Anlass für meinen Blogeintrag.
Moralischer Appell: Aufruf zum Plastikfasten
Fastenzeit. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) schlägt vor: Plastikfasten. Oh weh. Die Kampagne bewirkt höchstens, dass die Menschen feststellen, wie extrem aufwendig ein Leben ohne Plastik ist.
Gewiss, einige Verhaltensregeln lassen sich recht leicht umsetzen. So dürfte es nicht so schwer fallen, Getränke in solchen Flaschen zu kaufen, die gereinigt und neu befüllt werden. Aber wie bekommt man Käse ohne Verpackung? Und ist das überhaupt besser, wenn ich meinen Behälter spüle, als eine dünne Folie? Ist das hygienisch okay?
Damit wir uns nicht falsch verstehen, es ist richtig, wenn es den Menschen gelingt, ihren Plastikkonsum zu verringern. Ich selbst fahre wöchentlich zum Markt und lasse mir am Käsestand die Ware
direkt über die Theke reichen und packe ihn in meine dafür vorgesehene Dose. In der COVID-Krise braucht es Überredungskünste, damit der Händler das macht. Aber zu hoffen, dass 20 oder 40
Millionen andere Bürgerinnen mitmachen ist völlig realitätsfern.
Effektiver sind da aus meiner Sicht Kampagnen, die auf strukturelle Reformen zielen. Ob Petitionen, Briefe an die Landes- und Bundespolitiker, Bürgerbegehren oder Demonstrationen, mit diesen
Strategien kennt sich der BUND bestens aus. Lieber für systemische Veränderungen kämpfen, als die Leute mit Verzichtsappellen behelligen.
Verpufft die Kampagne also völlig wirkungslos? Nun vielleicht macht sie die Adressaten nachdenklicher. Vielleicht bekommen manche ein schlechtes Gewissen beim Blick in ihre Gelbe Tonne. Und das
fördert dann womöglich die Offenheit für gesetzliche Standards, die den Plastikmüll verringern.
Es kann sie geben, die guten Dinge
Im Wort zur Ökoroutine habe ich gelegentlich auf meinen Wunsch hingewiesen, die Gewährleistung für Elektrogeräte zu verlängern. Es ist ärgerlich für die Konsumenten und schlecht für die Umwelt, wenn ein Geschirrspüler schon nach drei Jahren den Geist aufgibt.
Land Rover Defender - Das Auto für den Alltag
Eine Leserin schickte mir vorgestern den Link zu einem WerbeClip. Mit dem Kommentar: »Klassisches Alltagsauto. Geil, dass die damit sogar Werbung machen«.
Klimaschutz ganz ohne Technik
Im Wuppertal Institut ist es inzwischen unumstritten, dass die Klimaziele nur erreichbar sind, wenn die Menschen ihr Verhalten ändern. Viele andere Institute teilen diese Einschätzung. Nun kommt die Internationale Energieagentur IEA in ihrem jüngsten Jahresbericht, dem World Energy Outlook, zu einer ähnlichen Schlussfolgerung.
Verhaltensveränderungen können Treibhausgase schnell reduziert. Die IEA hat elf verhaltensbezogene Maßnahmen untersucht. Besonders relevant sei der Verkehr. Hier ließe sich eine Reduktion um 20
Prozent eher leicht umsetzen.
Erstens: Flüge unter einer Stunde werden durch Bahnfahrten ersetzt, zweitens Strecken unter drei Kilometer zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt und drittens die Geschwindigkeit im Straßenverkehr wird um sieben km/h verringert.
Sehr extrem sind diese Maßnahmen in meinen Augen nicht. Ein gewaltiger Effekt ganz ohne teure Technik. Theoretisch wäre das sofort machbar. Vermutlich werden es die meisten Menschen vernünftig
finden, kurze Wege mit dem Rad zurückzulegen; und etwas langsamer zu fahren, dürfte auch nicht schwer fallen.
Es wird Zeit, dass die große Politik auch über den sozialen Wandel spricht, über Maßnahmen, die nicht einen Cent kosten, statt über das Wasserstoffflugzeug zu fantasieren.
Verbrauchertäuschung?!
Heute ganz kurz. Auf den letzten Blog »Wie die Fleischindustrie vegane Burger bekämpft« hat ein Leser geantwortet:
Das Veggie-Wurst Dogma ist tatsächlich lustig, wenn man sich die Verbots-Befürworter anschaut, die normal zu den Öko-Diktatur-Warnern zählen.
Wir sollten bei der EU den Antrag stellen, folgende irreführenden Bezeichnungen zu verbieten: Fleischsalat, Wurstsalat, Fischsalat, Leberkäse, Fleischkäse, Kräutersteak, Paprikasteak, Fleischpflanzerl, Orginal Bayerische Fleischpflanzerl, Quark-Wurst-Pflanzerl
Was für skandalöse Konsumententäuschungen!
Lidl fordert mutige Politik
Es ist nicht neu, dass die Landwirte unter dem Preisdiktat der großen Lebensmittelhändler leiden. Anfang Dezember haben wütende Bauern ihrem Ärger vorm Zentrallager von Lidl Ausdruck verliehen.
In Cloppenburg blockierten nach Polizeiangaben zeitweise bis zu 140 Traktoren die Zufahrt.
Ich weiß nicht, warum die Bauern sich ausgerechnet Lidl ausgesucht haben. Es hätte vermutlich auch genauso gut Aldi oder Netto sein können.
Seit vielen Jahren ist Lidl bestrebt, sein Image zu verbessern. Es fing an mit Produkten aus fairem Handel, die man ins feste Angebot aufgenommen hat. Und zuletzt sorgte die Kooperation mit
Bioland für viel Aufsehen. Das ist doch schon mal was.
Da kommt die Traktorenblockade ungelegen. Um darauf öffentlichkeitswirksam zu reagieren, veröffentliche der Discounter aus Neckarsulm Anzeigen mit einer Stellungnahme.
Interessant fand ich diese Formulierung: »Als Lebensmittelhändler kann Lidl die Problematik nicht alleine lösen. Um die Lage in der Landwirtschaft nachhaltig zu verbessern, sind mutige Schritte
seitens der Politik, Verarbeitern und unseren Mitbewerbern erforderlich, bei denen wir ausdrücklich unterstützen werden.«
Es ist tatsächlich so, dass Lidl nicht alleine das Problem lösen kann. Wenn sie deutlich besser zahlen, wären die Lebensmittel teurer, und die Leute würden nicht mehr beim Lidl einkaufen. So
einfach ist das.
Also, Lidl wünscht sich eine mutige Politik. Aber als ausgerechnet Julia Klöckner etwas Mut bewies, war es dann auch nicht recht. Die CDU-Politikerin hatte einen Gesetzesentwurf auf den Weg
gebracht, mit dem Landwirte und kleinere Lieferanten besser vor dem Preisdruck der Handelsriesen geschützt werden sollen, und von unfairen Umgangsformen gesprochen.
Da bekam Bundeskanzlerin Angela Merkel einen empörten Brief der großen deutschen Handelsketten. Das sei ja alles gar nicht so.
Daran müssen sich PolitikerInnen wohl gewöhnen. Auf der einen Seite wird von Ihnen Entschlossenheit und Mut gefordert, auf der anderen Seite macht man ihnen genau das zum Vorwurf.
Schleswig-Holstein baut neue Bahnstationen
Gestern Abend ging es beim Tischgespräch um Verkehrspolitik und was alles schief läuft. Sandra meinte dann: Ja, stimmt, aber man darf nicht aufgeben!
Stimmt. Ich finde es wichtig, sich immer zu vergegenwärtigen, wo wir herkommen. Also umweltpolitisch. Und da fiel mir vor einigen Tagen diese Grafik in die Hände. Eine positive Nachricht!
In der Zeit von 1998 bis 2015 hat Schleswig-Holstein 34 neue Bahnstationen eröffnet. Bis auf eine werden sie sehr gut angenommen. Derweil sind sieben weitere neue Bahnstationen in Planung, bis 2025 sollen sie eröffnet werden.
Es wird nicht alles schlechter. Und auch bei der Deutschen Bahn geht es seit vielen Jahren aufwärts. Endlich. Das macht sich zwar erst allmählich bemerkbar, weil man über zwei Jahrzehnte kaum in
Züge und Strecken investiert hat – Rückbau, statt Ausbau. Aber das ist Geschichte.
Im Widerspruch dazu stehen tausende Kilometer neuer Straßen, die Bund, Land und Kommunen noch bauen möchten.
Aber ich wollte ja heute etwas Positives schreiben.
Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag.
Autofans stoppen Tramprojekt
In der Umweltbewegung hat man lange geglaubt, Bürgerbeteiligung ist automatisch gut für den Umweltschutz. Das ist nicht so. Das erste mal begegnete mir diese Erfahrung Mitte der 1990er Jahre, ich habe in Oldenburg noch Umweltpolitik studiert.
In München sprach sich damals die ansässige Lokale Agenda 21 Initiative für einen Autobahn Tunnel in der Landeshauptstadt aus. Immer wieder gibt es solche Nachrichten.
In Berlin votierten die Bürger*innen dagegen, den Flughafen Tegel nach Fertigstellung des BEE zu schließen. Anwohner kämpfen gegen den Umbau eines Parkstreifens zu einem Radweg und
Autoenthusiasten gegen eine Busspur. Es kommt auch häufig vor, dass Bürger*innen lieber auf eine Baumpflanzung verzichten als auf einen öffentlichen Parkplatz vorm Haus – auch wenn sie ihren
Wagen im Hinterhof abstellen können oder über eine Garage verfügen.
Das sind schon frustrierend Momente. Zwar begrüßt die breite Mehrheit die Vision einer autoarmen Stadt. Das ganze Blech, der Lärm und Gestank ist ja auch äußerst unangenehm. Aber wehe, vor der
Haustür soll sich etwas ändern.
Und so konnte auch die Schlagzeile von der TAZ nicht überraschen. »Autofans stoppen Tramprojekt«
Wiesbaden wird laut Bürgerentscheid keine Straßenbahn bekommen. Und das Gegenargument, bitte gut festhalten, für die Tram würden zu viele Parkplätze geopfert.
Tja, offenbar sind Politikerinnen gar nicht so unfähig wie Kritiker behaupten. Vielmehr hakt es nicht selten an der Unfähigkeit der Bürger, sich eine andere Mobilität vorzustellen, überhaupt an
der Bereitschaft, Veränderungen zu akzeptieren.
Im Stadtrat waren sich die großen Parteien einig, was selten genug vorkommt. SPD, CDU und Grüne haben für das Projekt geworben. Noch dazu Fridays for Future, der Allgemeine Deutsche
Fahrradclub, auch die Industrie- und Handelskammer und der Deutsche Gewerkschaftsbund.
Doch in Wiesbaden stimmten 62 Prozent gegen und nur 38 Prozent für das Projekt. Die Beteiligung war mit 45 Prozent hoch. Leider überwiegte die Dummheit und das nicht mal knapp. Tut mir leid, aber
das wird man ja wohl sagen dürfen. Jetzt wird man einwenden, die Menschen waren nicht gut genug informiert, man muss die Leute mitnehmen la, la, la.
Sorry, wenn die drei großen Parteien und top organisierte Verbände für eine Stadtbahn trommeln, dann mangelt es bestimmt nicht an Informationen und werbenden Gesprächen. In Würzburg weigern sich Anwohner gegen die Verlängerung einer Straßenbahnlinie. Ich möchte gar nicht wissen, wo noch zukunftsfähige Mobilitätsprojekte blockiert werden.
Soweit mein nachdenklicher Blog zum Sonntag. Ich wünsche Euch eine schöne Woche.
Das viele Geld für Landwirte
Für den Laien ist auf Anhieb kaum zu beurteilen, ob unsere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner bei den Verhandlungen mit den EU-Agrarministern etwas erreicht hat auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Sie habe hart verhandelt und das maximal mögliche ausgehandelt, sagte Frau Klöckner bei der Pressekonferenz. Dieser Bericht beim Deutschlandfunk fasst gut zusammen, worum es geht.
Das Normgemüse: Überzogene Standards, ganz freiwillig
Das Konzept der Ökoroutine beinhaltet auch steigende Standards.
Hohe Standards sind jedoch nicht in jedem Fall positiv. Das macht eine Studie des Umweltbundesamtes deutlich. Weil Äpfel makellos, Möhren gerade und Kohlrabi mit frischem
Blattgrün versehen sein müssen, werden unnötige Dünge- und Pflanzenschutzmittel eingesetzt und Produkte entsorgt, die nicht den Anforderungen entsprechen.
Verantwortlich dafür sind keine Gesetze, sondern die Vorgaben des Lebensmitteleinzelhandels.
Offenbar fällt es den Konzernen an dieser Stelle überhaupt nicht schwer, höhere Standards festzulegen. Überhaupt ist das in der freien Wirtschaft allgegenwärtig. Das heißt dann
Qualitätsmanagement. Da gibt es Vorgaben, die bis auf den hundertsten Millimeter einzuhalten sind, über viele Vor-Produzenten hinweg – die Ökonomen sprechen von »Wertschöpfungsstufen«.
Vor diesem Hintergrund ist das sogenannte Lieferkettengesetz ebenso angemessen wie dringlich. Selbstverständlich können Unternehmen die Verantwortung etwa für die Fertigung von Textilien übernehmen, auch in fernen Ländern. Sie tun es jetzt schon, damit die teuren Hemden von Hugo Boss, Esprit und Helly Hansen nicht krumm und schief genäht werden.
Vom Parkdeck zur Radstation.
Von der Auto- zur Radelroutine ist es ein weiter Weg. Karlsruhe ändert die Strukturen und schafft Platz für Radlerinnen.
Was mich sehr beeindruckt hat: Wo vorher 38 Autos parken konnten, ist jetzt Platz für 680 Räder. Hier wird erneut besonders deutlich, wieviel Platz Autos benötigen. Und: Nur eine kleine
Einschränkung für den Autoverkehr, also 38 Parkplätze weniger, schafft enorm viel Raum für Radler.
Keynes und enkeltaugliche Wirtschaftsförderung
Doch mit der Coronakrise ist noch ein zweiter Gedanke von Keynes populär. Der bis heute viel zitierte Ökonom vertrat die Einschätzung, dass die Produktion von Gütern nur dann ins nahe oder ferne Ausland verlagert werden sollte, insofern es sinnvoll und notwendig erscheint.
Der freie Waren- und Kapitalverkehr ist demnach nicht automatisch zum Wohle aller. Besser sollten Produzenten und Endverbraucher, wann immer dies sinnvoll und möglich ist, ein und demselben
Wirtschaftsraum angehören. Keynes bezweifelte nicht, dass der Handel mit Gewürzen, Bananen, Öl, Zink und dergleichen sinnvoll ist. Die überwiegende Anzahl der Produkte könnten die Länder
allerdings selbst herstellen. Diese Überlegungen hat der berühmte Ökonom bereits in den 1930er Jahren angestellt und zumindest theoretisch stimmt es immer noch.
Wir sind extrem abhängig von Export und Import geworden. Länder und letztlich auch Kommunen und Regionen sind politisch selbstständiger, wenn sie nicht ständig die Abwanderung von Kapital und
Arbeitsplätzen ins Ausland befürchtet müssen. In diesem Sinne sind die Forderungen zu verstehen, zumindest systemrelevante Produkte und Dienstleistungen wieder näher an die Bundesrepublik oder
zumindest in die EU heranzuholen.
Irrweg: CO₂-Kennzeichnung für Lebensmittel
Der wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik und Ernährung, mit das wichtigste Beratungsgremien im Bundesagrarministerium, fordert verbindliche CO₂-Angaben auf Lebensmittelverpackungen.
Das halte ich für einen fatalen Rat. Wieder soll es der Konsument richten. Was haben denn all die Label für faire und ökologische Produkte gebracht? Öko-fair ist immer noch eine Nische. Es ist
enorm aufwendig, den CO2-Rucksack von Lebensmittel zu bewerten. Zeitverschwendung, denn der Effekt dürfte wie auch in den letzten Jahrzehnten im kaum wahrnehmbaren Bereich liegen.
Für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft muss die Europäische Union ihre Subventionspolitik ändern. Strukturelle Reformen machen die Agrarwende möglich, nicht Label-Appell.
Klimaschutz in Osnabrück am Ende?
Als ich mir jetzt den Klimaschutzbericht in Osnabrück angesehen habe dachte ich, gleich trifft mich der Schlag. In der Einleitung noch der fröhliche Singsang des Oberbürgermeisters, wir »haben so manches mal Mut bewiesen« und »sind mit innovativen Projekten bundesweit vorangegangen«.
Und dann heißt es lapidar, man habe das Ziel um 12 Prozent verfehlt. Okay, das ist nicht schön, das kriegen wir schon hin. Jetzt packen wir es richtig an.
Doch die Bilanz ist in weiten Teilen erschütternd. Und das trotz vieler gelungener Maßnahmen und der vielen vorbildlichen Absichten.
Die Bilanz im Bereich Verkehr ist ein Desaster. Die »Zielerreichung« für den Verkehr liegt bei +11 Prozent, angestrebt bis 2030 werden -41 Prozent. Der Zustand hat sich also erheblich
verschlechtert, weil die Zahl der Autos zunahm, ebenso wie Pendelfahrten. Der Straßenausbau hat dazu massiv beitragen.
Zu rund 1/3 befeuern die Osnabrücker die Klimahitze mit ihren Öfen im Winter. Viele Heizungen sind inzwischen super modern und besonders die neuen Gebäude recht gut gedämmt. Dennoch gibt es seit
2010 keinen Rückgang beim CO2. Kein Wunder, es kommen ständig neue Häuser dazu.
Die Bilanz dürfte sich noch weiter verschlechtern in den Folgejahren, wenn man bedenkt wie viele Wohnungen in 2017, 2018 und 2019 entstanden sind. Besonders zusätzliche Einfamilienhäuser verschlechtern die Bilanz.
Doch es gibt immerhin einen Lichtblick: Die Wirtschaft hat CO2 bereits um 66% reduziert, angestrebt waren -41% . Feiern kann sich dafür die Osnabrücker Politik jedoch nicht, denn dieser Erfolg
liegt quasi außerhalb ihres Einflussbereiches.
Wir müssen beginnen, uns selbst ernst zu nehmen beim Klimaschutz, und endlich Maßnahmen ins Werk setzen, die sich nicht nur nett anhören, sondern auch tatsächlich einen nennenswerten Beitrag zur
Minderung der Klimahitze beitragen.
Was müsste geschehen? Hier nur einige Stichworte:
- Solarenergie sollte für Neubauten zum Standard werden
- Busbeschleunigung jetzt zügig vorantreiben
- Parkplatzbewirtschaftung muss zum Umstieg auf Nahverkehr und Rad motivieren
- PopUp-Radwege sollten sofort das Radfahren sicherer machen
- Neubau von Einfamilienhäusern nur noch in Ausnahmefällen ermöglichen (etwa auf Hintergrundstücken)
Der Fahrplanmechanismus
Heute mal ein etwas längerer Blog. Kurzfassung: Die Wirtschaft kann sich ganz doll verändern, aber man muss ihr Zeit und Perspektive dafür geben. Ich spreche hier von Fahrplänen. Diese Form der Steuerung, Planung, Lenkung oder wie auch immer man das nennen mag, ist vornehme Aufgabe der Politik.
Zu radikal?

CarSharing: Was motiviert?
Ich habe mir viele Gedanken zu den wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen und Chancen der gegenwärtige Krise gemacht. Doch inzwischen finde ich Nachrichten richtig erholsam, die mal nichts damit zu tun haben.
Strukturen ändern Routinen, lautet das Credo der Ökoroutine. Ganz konkret wird das beispielsweise bei den Anwohner-Parkgebühren.
Manchmal habe ich das Gefühl, wesentlich liberaler zu sein als viele FDP Mitglieder. Ich fände es gut, wenn man es den Städten überließe, die Gebühren fürs Parken vor der Haustür festzulegen.
Das hat sich wohl auch das Land Berlin gedacht. Berlin hat im Bundesrat dafür geworben, den Deckel für Anwohnerparken von bisher maximal 30,70 Euro pro Jahr auf bis zu 240 Euro anheben zu lassen.
Minister Scheuer bezeichnete die Anhebung der Obergrenze als »überzogen«. Der Antrag scheiterte.
Das bedeutet, für private Autos gilt weiterhin: Das Parken auf öffentlichen Flächen gibt es praktisch für lau! Wie in diesem
Blog bereits ausgeführt, zahlen die Anwohnerinnen in vielen Städten Europas locker zehn bis 20 mal soviel. In Amsterdam zum Beispiel über 500 Euro. Wenn Parken in unseren Städten 300 Euro pro
Jahr kosten würde und CarSharing-Parken hingegen nichts, das wäre mal ein schöner Anreiz für den Wechsel.
Ist der Vorschlag aus Berlin wirklich überzogen?
Alles wird gut?!
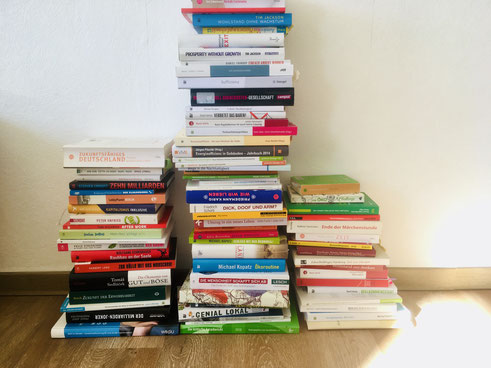
Der Staat beschützt seine BürgerInnen
Dem Staat, also unserer Gesellschaft, kann es nicht gleichgültig sein, ob die Mitbürgerinnen fahrlässig mit ihrem Leben umgehen. Deswegen sind beispielsweise viele Drogen verboten.
Die Rauchverbote hatte man jedoch formal nicht beschlossen, um die Raucher vor sich selbst zu schützen, vielmehr ging es um die Gesundheit der »Passivraucher«. Deren Recht auf freie Entfaltung und körperliche Unversehrtheit werde etwa in Gaststätten eingeschränkt.
Dagegen nimmt der Gesetzgeber die Einschränkung der Freiheitsrechte durch Lärm, Schadstoffe und Verletzte im Straßenverkehr vergleichsweise gelassen hin (siehe Blog »Sind Autos sind verfassungswidrig?«). Dabei ist es unbestritten, dass die gesundheitlichen Belastungen durch Straßenverkehr die Lebenszeit der Betroffenen erheblich verkürzt.
Jede Maßnahme, die dazu beitragen soll, den Autoverkehr zur verringern, sollte man mit den Freiheitsrechten der von Lärm betroffenen Menschen begründen. Und auch ein geschützter Radweg, schön breit und sicher, ist ein Beitrag für die Freiheit von VerkehrsteilnehmerInnen. Im Namen der Freiheit müssen sich daher manchmal auch mal Parkplätze zu Radspuren weiterentwickeln
Du entscheidest, meint Frau Klöckner

Downgrade: Klöckner möchte Standards verschlechtern






































